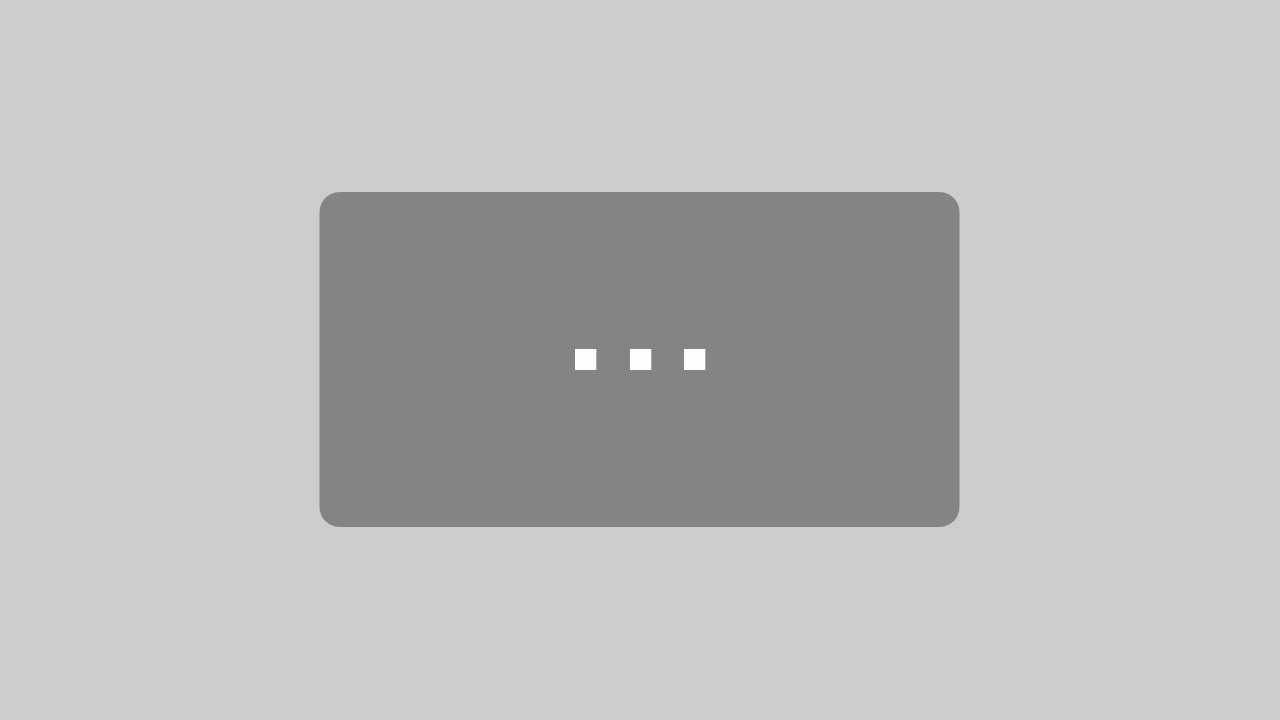Aus der aktuellen loyal: „Ich bin kein Staatsfeind“ (Teil 2)
von Marco Seliger
mit Illustrationen von Bernd Schifferdecker
Er habe erwartet, in Miran Schah für den Guerillakampf gegen die "Amerikaner und die anderen westlichen Besatzer" ausgebildet zu werden, sagte Thomas K. Anfangs sah es auch danach aus. Die Taliban brachten ihn mit drei anderen Kämpfern im Gästehaus eines Mannes namens Yasser unter. Thomas K. bekam monatlich 1.000 Rupien (etwa 7 Euro) sowie kostenlose Verpflegung. Er lernte den Umgang mit der Kalaschnikow. Im Haus, berichtete er, habe es zwei Waffen gegeben. Er habe damit schießen dürfen, wann immer er wollte. Er sei stolz darauf gewesen, da Munition knapp und teuer gewesen sei. Dann die Ernüchterung: Als Thomas K. Yassir fragte, ob er ein militärisches Ausbildungslager der Taliban besuchen könne, lehnte sein Gastgeber ab. Er sei körperlich und mental nicht stark genug, um für den Kampf zu trainieren, habe Yassir erklärt. Er sei darüber sehr traurig gewesen, erklärte Thomas K. dem Gericht.
Anschluss ans "Haqqani-Netzwerk"
Daraufhin schloss er sich dem "Haqqani-Netzwerk" an, einer Terrororganisation, die im Osten Afghanistans und in der Hauptstadt Kabul für zahllose Selbstmordanschläge verantwortlich ist. Ihr Gründer, Dschalaluddin Haqqani, bekämpfte die Taliban in den 1990er Jahren, lief dann aber zu ihnen über. Dafür belohnten sie ihn mit einem Ministerposten in ihrer Regierung. Haqqani galt zeitweise als wichtigster Mann bei den Taliban nach ihrem Führer Mullah Omar. Nach dem Sturz des Regimes in Kabul in Folge der amerikanischen Intervention im Jahr 2001 zog er sich in das Grenzgebiet zu Pakistan zurück und organisierte von dort aus den Kampf gegen die amerikanischen und afghanischen Truppen. Auch die Anschläge auf die deutsche Botschaft in Kabul im Jahr 2017 und auf das deutsche Konsulat in Mazar-i-Sharif ein Jahr zuvor werden dem Haqqani-Netzwerk zugeschrieben.
Aufnahme in die "Selbstmordabteilung der Taliban"
Thomas K. wurde der Abteilung für Selbstmordanschläge zugeteilt und ließ sich "als Zeichen seines guten Willens" auf eine Liste setzen, auf der die Namen freiwilliger Selbstmordattentäter standen. Seine Aussagen zu den Gründen sind widersprüchlich. Einerseits sagte er, Selbstmordattentate seien unislamisch und terroristisch. Andererseits bezeichnete er Selbstmordattentäter als "normale" Menschen. Dass er sich auf die Liste setzen ließ, versuchte er dem Gericht als eine "Art krimineller Phase" zu erklären. Er sei aber "kein klarer Befürworter" dieser Form des Dschihad gewesen, sondern habe die Taliban vielmehr von diesem "Irrweg" abbringen wollen.

Das ist unglaubwürdig. Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) sagte vor Gericht aus, das Haqqani-Netzwerk sei "die Selbstmordabteilung der Taliban". Dort kämen "nur ausgewählte Leute" hin. Thomas K. hingegen erklärte, er habe sich dort vor allem mit dem Studium islamischer Literatur beschäftigt, in der Küche geholfen und Holz gehackt. Die Bundesanwaltschaft glaubte ihm das nicht und warf ihm vor, seine Taten zu verharmlosen. "Die Taliban sind doch kein Sanatorium für psychisch labile Faulpelze", sagte die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer. Thomas K. sei sehr viel tiefer in die Strukturen des Haqqani-Netzwerkes eingebunden gewesen, als er es dem Gericht glauben machen wollte. Der Angeklagte muss sich unter den Selbstmordattentätern jedenfalls wohl gefühlt haben. In einem abgehörten Telefonat mit seiner Mutter aus dieser Zeit sagte er, er spüre "eine wahre Glückseligkeit und Freiheit in seiner Seele". Er habe endlich gefunden, wonach er gesucht habe.
Auch als Auto-Attentäter nicht geeignet
Es gibt Hinweise darauf, dass die Taliban planten, Thomas K. als Selbstmordattentäter mit einem Auto einzusetzen. Dafür spricht, dass er ein Fahrtraining mit einem Toyota Corolla begann. Mit solchen Autos haben die Taliban schon viele Selbstmordanschläge verübt. Doch Thomas K. stellte sich sehr ungeschickt an. Bei seinem Übungsauto habe das Lenkrad rechts gesessen, was ihn verwirrt habe, berichtete er dem Gericht. Die Taliban brachen die Ausbildung ab. Anschließend habe ihm sein Fahrlehrer gesagt, er sei auf der Liste der freiwilligen Attentäter weit nach unten gerutscht. Für ihn, so erklärte Thomas K., habe das Fahrtraining indes nur das Ziel gehabt, sich mit dem Auto vertraut zu machen, um es dann ferngesteuert und mit Sprengstoff beladen in einen US-Militärkonvoi zu fahren. Seine Absicht sei es gewesen, den Anschlag zu filmen, um ihn in ein Propagandavideo einzubauen. Wie wichtig ihm dabei die Tötung von US-Soldaten war, machte eine Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes gegenüber dem Gericht deutlich. Sie hat Thomas K. nach seiner Festnahme in Deutschland Ende April dieses Jahres vernommen. "Er sagte, der Angriff auf die US-Truppen wäre das Sahnehäubchen in seinem Video gewesen", berichtete sie.
Worte und Taten stimmen nicht überein
Thomas K. erklärte während des Prozesses mehrfach, die Tötung amerikanischer Soldaten sei legitim, da es sich bei ihnen um Besatzer handele. Der Kampf gegen afghanische Soldaten aber sei unislamisch. Sie seien schließlich ebenso Muslime wie die Taliban. Doch auch hier stimmten Worte und Taten nicht überein. Denn Thomas K. hat sich an einem Angriff auf einen Stützpunkt der afghanischen Armee nahe der Grenze zu Pakistan beteiligt. Dem Gericht erklärte er, die Taliban-Gruppe nur begleitet zu haben, um den Angriff zu filmen. Einige Kilometer von dem Camp entfernt hätten sie einen Mörser aufgestellt und mehrere Granaten abgefeuert.

Der Umgang mit einem Mörser ist einfach. Die Waffe besteht aus einem etwa einen Meter langen Rohr mit Bodenstück, dem Zweibein, einer Bodenplatte und einem Richtaufsatz, um das Ziel anzuvisieren. In das Rohr wird eine Wurfgranate gesteckt, die beim Aufschlagen auf den Boden zündet und in einer steilen Flugbahn vor allem gegen Ziele eingesetzt wird, die sich hinter steilen Deckungen befinden. Das kann zum Beispiel eine Mauer sein.
Bei dem Angriff auf den afghanischen Stützpunkt, behauptete Thomas K., sei niemand zu Schaden gekommen. Woher er das weiß, blieb unklar. Dann aber habe er die Kamera einem Taliban gegeben und selbst eine Granate abgefeuert. Dabei sei er gefilmt worden. "Das habe ich aber nur getan, weil mir der Kommandeur versichert hat, dass von 100 Schüssen nur zwei bis drei treffen", sagte K. Er habe niemanden töten wollen.
"Taliban sind keine Reiseagentur für abenteuerlustige Mitteleuropäer"
Auch das glaubte ihm die Bundesanwaltschaft nicht. Die Taliban seien "eine Terrororganisation und keine Reiseagentur für abenteuerlustige Mitteleuropäer", sagte die Vertreterin der Anklage. Die Behauptung, die Taliban würden einen afghanischen Stützpunkt angreifen, um niemanden zu töten, sei Unfug. Die Verteidigung von Thomas K. hingegen erklärte, die Angreifer hätten den afghanischen Stützpunkt gar nicht sehen können. Er sei viel zu weit weg gewesen.
Der Mörser-Angriff spielte im Gerichtsprozess eine zentrale Rolle. Er begründete den schwerwiegenden Vorwurf des versuchten gemeinschaftlichen Mordes gegen Thomas K. Doch Beweise, die belegen, dass er bei dem Angriff Menschen getötet oder verletzt hat, konnte die Bundesanwaltschaft nicht vorweisen.
 "Versetzung" nach Helmand
"Versetzung" nach Helmand
Im Herbst 2016, er war zu diesem Zeitpunkt mehr als drei Jahre beim Haqqani-Netzwerk, bat Thomas K. seine Kommandeure um "Versetzung" nach Helmand. Was dazu geführt hat, lässt sich aus seinen Aussagen nur erahnen. Im Juni 2014 hatten Pakistans Streitkräfte eine groß angelegte Militäroffensive in Nordwaziristan eröffnet. Damit reagierte die Führung des Landes auf einen Terrorangriff auf den Flughafen in Karatschi, zu dem sich die Tehrik-i-Taliban Pakistan bekannt hatten. Ziel der mehrjährigen Operation war es, alle militanten Gruppen aus Nordwaziristan zu vertreiben. Damit hatte die pakistanische Regierung erstmals mit den Taliban gebrochen. Er habe aus Pakistan nach Afghanistan fliehen müssen, berichtete Thomas K. Doch auch in Ostafghanistan habe er nicht Fuß fassen können. Die Taliban schickten ihn von einem Ort zum nächsten. Er war ständig auf der Flucht. So hatte er sich den Dschihad nicht vorgestellt.
In Helmand, einer Taliban-Hochburg in Südafghanistan, schloss sich Thomas K. einer "Red Unit" an. Das sind mobile und gut ausgerüstete Kampfeinheiten der Taliban. Allerdings habe er nicht gekämpft, sondern sich vor allem als Vorbeter betätigt und Wachdienste geleistet. Thomas K. hat diese Zeit als ausgesprochen positiv in Erinnerung. Er habe sich in Helmand heimisch und aufgehoben gefühlt und sogar eine Hochzeit ins Auge gefasst, sagte er. Ein Taliban habe ihm seine Tochter als Ehefrau angeboten und dafür 5.000 US-Dollar als Mitgift versprochen. Doch aus der Hochzeit wurde nichts.
Gefangennahme durch afghanische und amerikanische Spezialkräfte
Wie genau die Gefangennahme von Thomas K. am 28. Februar 2018 abgelaufen ist, ließ sich der Verhandlung in Düsseldorf nicht entnehmen. Bekannt ist, dass neben dem deutschen Konvertiten zwei weitere Taliban in die Hände der amerikanischen und afghanischen Spezialkräfte gefallen sind. Von dem Film mit den Aufnahmen des Angriffs auf den afghanischen Stützpunkt wussten die Amerikaner nichts. Es war Thomas K. selbst, der ihnen und später auch dem Bundeskriminalamt davon erzählte. Es gibt Hinweise darauf, dass er das gegenüber den Amerikanern unter Folter oder Androhung von Folter getan hat. Einer seiner Anwälte sagte, ein Teil der Aussagen sei durch "verbotene Vernehmungsmethoden" in Bagram zustande gekommen. In Bagram befindet sich der größte amerikanische Stützpunkt in Afghanistan. Thomas K. war dort längere Zeit in Isolationshaft.

Was er genau mit "verbotene Vernehmungsmethoden" meint, hat der Anwalt nicht weiter ausgeführt. Thomas K. sagte vor Gericht, er sei in einer engen Zelle ohne Licht untergebracht gewesen und habe nur einmal pro Woche das Tageslicht gesehen. Ihn habe ein "am ganzen Körper tätowierter" Amerikaner verhört, der sehr furchteinflößend gewesen sei. Weil er sehr schlecht Englisch spreche, habe er nur wenig verstanden. Der Mann habe gedroht, ihn zwei Jahre lang "im Bunker" verschwinden zu lassen. Damit seien Geheimgefängnisse in Afghanistan gemeint. Was die Amerikaner von ihm wissen wollten, ob er Verstecke und Namen von Taliban verraten hat, das wurde während der Verhandlung nicht thematisiert.
Prozess legt Schwierigkeiten der deutschen Justiz offen
Der Prozess gegen den "deutschen Taliban" hat die Schwierigkeiten deutlich gemacht, mit denen die Justiz bei der Aufarbeitung islamistischer Verbrechen von Deutschen in ausländischen Kriegsgebieten konfrontiert ist. Konkrete Vergehen, die eine lange Haftstrafe rechtfertigen, sind nur schwer zu belegen. Auch im Fall von Thomas K. hat das Gericht den Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes aus Mangel an Beweisen nicht berücksichtigt. Statt einer Freiheitsstrafe von acht Jahren, wie es die Anklage gefordert hat, muss Thomas K. wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz nun sechs Jahre in Haft. Er erkenne das Urteil als gerechte Strafe an, erklärte er. Was er allerdings nicht akzeptiere, das sei der Vorwurf, er sei ein Terrorist und Bombenbauer. "Ich bin kein Staatsfeind", erklärte er zum Prozessende.