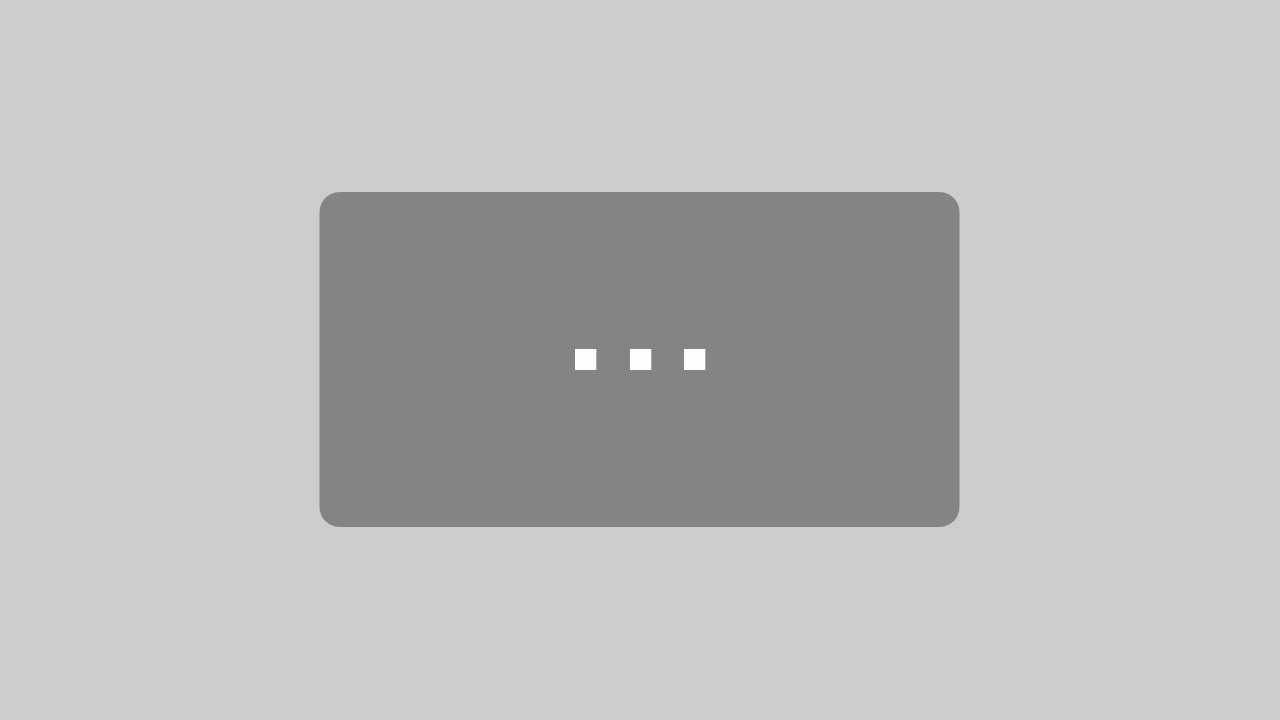Wie bereitet man sich als Journalist auf eine Reise in ein Kriegsgebiet vor? Und wer oder was ist ein Fixer? Konstantin Flemig ist Autor, Dozent und Kriegsreporter und mehrfach in Krisenregionen im Nahen Osten, in Afrika und Osteuropa unterwegs gewesen. Wie es ist, als freiberuflicher Journalist Reportagen in den gefährlichsten Regionen der Welt zu drehen und wie sein Alltag im Konfliktjournalismus funktioniert, erläuterte Flemig dem Arbeitskreis für Sicherheitspolitik an der Universität Münster.
Gefahr war das Stichwort, das die Teilnehmenden am meisten mit dem Beruf eines Kriegsreporters assoziierten. Zurecht: Neben einer Vielzahl an Kamera- und Tonequipment sowie einer kleinen Drohne gehören Kevlarweste und Stahlhelm für Flemig bei seinen Reportagereisen zur Standardausrüstung.
Gerade als Zivilist sei die Arbeit in einer Krisenregion herausfordernd. Umso wichtiger sei deshalb die Planung eines Einsatzes und die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Region vor der Reise, schilderte Fleming. Durch Literaturrecherche und Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen verschaffe er sich ein Verständnis für die Region, deren Geschichte und Kultur, erläuterte der Journalist. Er zeigte jedoch auch, dass oft nicht alles nach Plan geht und vor Ort improvisiert werden muss. Gerade für solche Fälle hob Flemig besonders die Rolle der sogenannten Fixer oder Stringer hervor, die als lokale Journalisten oder Aktivisten mit guten Ortskenntnissen Kontakte herstellen und die Sicherheitslage oft besser einschätzen können.
Flemig präsentierte bei der Veranstaltung eigenes Filmmaterial, das an der Front in Mossul entstanden ist, als die irakischen Streitkräfte die Stadt vom sogenannten Islamischen Staat zurückeroberten. Ein ständig abzuwägendes Dilemma sei immer, die eigene Sicherheit mit dem Ziel zu vereinbaren, die bestmöglichen Aufnahmen zu generieren. Bleibe man zu passiv, erreiche man womöglich die Ziele der Reportage nicht. Schätze man aber das Risiko falsch ein, könne innerhalb kurzer Zeit unmittelbare Gefahr für das eigene Leben bestehen, schilderte Fleming. Gleichzeitig ging er auf die teilweise absurden Momente ein, als der Reporter beispielsweise mit Gefechtsgeräuschen im Hintergrund mit den Soldaten über Fußball diskutierte.
Die wichtige Rolle des Fixers
Zuletzt konnten die Teilnehmenden Flemig ihre eigenen Fragen stellen. Dabei gingen sie weiter auf die Rolle der Fixer ein, die in der Berichterstattung oft wenig Anerkennung erhalten. Interessant war für die Studierenden auch die Marktdynamik. Demnach seien die Tagesgehälter von Fixern stark davon abhängig, wie stark das Interesse von großen amerikanischen Medienhäusern an einem Konflikt sei. Fleming argumentierte, dass der Kriegsjournalismus auch in Zeiten von Smartphones weiterhin relevant bleiben werde, um besonders in der deutschsprachigen Medienlandschaft Konflikte differenziert und verständlich abzubilden. Dabei plädierte er für eine Ausweitung der öffentlich-rechtlichen Auslandsberichterstattung.
Bei Fragen über den Beruf ging er darauf ein, dass Konfliktjournalismus definitiv keine strikte Männerdomäne sei und dass Frauen teilweise den Vorteil hätten, zwei Welten innerhalb eines Konflikts kennenzulernen: Frauen haben oftmals einen Zugang zur weiblichen Bevölkerung, der den männlichen Kollegen verwehrt werde. Flemig beschrieb außerdem die Schwierigkeit, den Beruf als Kriegsreporter mit Privatleben, Familie und mentaler Gesundheit in Einklang zu bringen, sowie die Überwindung der eigenen Emotionen zugunsten einer ehrlichen Berichterstattung.
Zum Schluss erläuterte Flemig, dass er Kriegsreporter geworden sei, um in der Gesellschaft Aufmerksamkeit für Ereignisse zu schaffen, die sonst gar nicht oder nur wenig thematisiert werden würden. Trotz der Frustration, die oft mit diesem Beruf verbunden sein können, will Flemig seine Arbeit nach der Pandemie fortführen, sei es in Afghanistan, Irak oder aber auch auf Lesbos, um die Geschichten der Menschen, die sich hinter den Schlagzeilen verbergen, zu erzählen. Sein aktueller Beitrag über den Krieg in Syrien ist auf YouTube zu sehen.