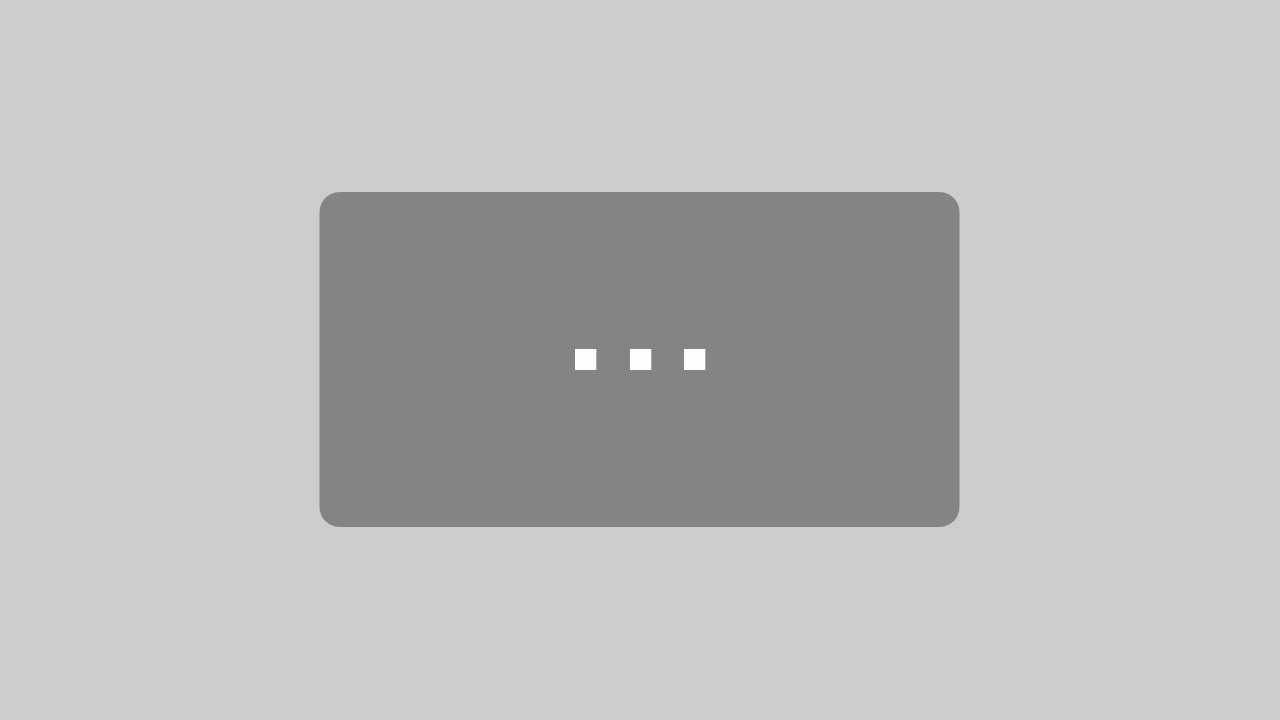72 Stunden im Keller
Ein leistungsfähiger Sanitätsdienst ist für die geforderte Kriegstauglichkeit genauso wichtig wie Panzer und Kampfschiffe. Doch der Krieg in der Ukraine zeigt, dass sich die Ausbildung von Rettungspersonal grundlegend ändern muss. Wegen der allgegenwärtigen Drohnen müssen Sanitäter an der Front in Kellern ziviler Häuser arbeiten. Im Sanitätsregiment 1 in Berlin fand dazu kürzlich die erste Ausbildung statt ‒ loyal war dabei.
Oberfeldarzt Ramon Roßnick ist sauer, dass wir die Hand vor Augen noch sehen. Kurz vor 22 Uhr stapfen wir in der Blücher-Kaserne am Rande Berlins auf das alte Feldwebelwohnheim zu, und es fällt noch Licht auf die schmale Kopfsteinpflastergasse vor uns. „Ich habe extra die Straßenlaternen hier ausschalten lassen, und jetzt kleben sie die Fenster nicht ab!“, sagt Roßnick, mehr zu sich selbst als zu seiner Begleitung. Ein kurzer Befehl, und das Problem wird behoben. Dann ist es wirklich sehr dunkel rund um die Rettungsstation, die die übenden Soldaten im Keller des alten Wohnblocks eingerichtet haben. Genauso, wie sie es von ihren ukrainischen Kameraden gelernt haben.
Darum wird es in dieser Montagnacht und den kommenden Tagen der 72-Stunden-Übung im Ausbildungszentrum des Sanitätsregiments 1 gehen, das Roßnick leitet. Das Ziel: Zutiefst schmerzhafte, oft verstörende „lessons learned“ der Ukrainer quasi intravenös in die Ausbildung des Sanitätsdienstes einzuleiten. Es ist eine Art kameradschaftliche Schocktherapie für die Bundeswehr, in der sich viele Verantwortliche auch im dritten Jahr der vollumfänglichen Invasion der Ukraine durch Russland nicht an eine höhere Schlagzahl anpassen können.
Die Umstellung für den Sanitätsdienst ist fundamental, wie allein ein Vergleich der Verwundetenzahlen zeigt. 37 Bundeswehrsoldaten sind seit 1992 in Gefechten oder bei Anschlägen getötet worden. Bei einem hochintensiv geführten Krieg hingegen rechnet der Sanitätsdienst mit weitaus mehr als 1.000 Toten und Verwundeten allein im Heer – und zwar täglich. So ist es in einer Analyse des German Institute for Defence and Strategic Studies nachzulesen, einem Thinktank des Verteidigungsministeriums. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu verstehen: Um von diesen Tausenden Verwundeten so viele wie möglich zu retten, muss die medizinische Versorgung in der Bundeswehr deutlich pragmatischer aufgestellt werden als bisher. Denn Sanitätspersonal ist rar und wegen der jahrelangen Ausbildung nur schwer zu ersetzen. Derzeit gibt es laut Sanitätsdienst rund 3.300 Humanmediziner in den Streitkräften, dazu 3.200 Einsatz- und Notfallsanitäter.
Aus den Fehlern der Ukraine lernen

So zynisch es klingt: Jeden Fehler, den die Ukraine bei der Verwundetenversorgung gemacht hat, kann Deutschland vermeiden, wenn es die Erkenntnisse von der Front gegen Russland in die Ausbildung einbezieht. Dazu gehört auch, dass Patientenbewegungen vor allem nachts stattfinden. „Tagsüber sind einfach zu viele Drohnen unterwegs“, erklärt Oberfeldarzt Roßnick und zieht am Feldwebelwohnheim eine schwarze Plastikplane zur Seite, die den Kellerraum abdunkelt. Auf einen Schlag stehen wir mitten im heute geübten Szenario. Das Sanitätspersonal betreibt einen sogenannten casualty collection point, eine Rettungsstation rund vier Kilometer hinter der Front. Hier sollen Verwundete stabilisiert werden, damit sie die Fahrt in die nächsthöhere Station der Rettungskette überleben – und das während eines Verzögerungsgefechts.
Der Gegner rückt also vor, während eigene Kräfte ihm das so schwer wie möglich machen. „Deswegen musste auch die Rettungsstation verlegt werden“, erklärt Roßnick. Statt der hochtechnisierten Sanitätscontainer der Bundeswehr nutzt die Übtruppe jetzt vorhandene zivile Infrastruktur, um der Drohnenaufklärung zu entgehen. Feuchte, dunkle Keller statt steriler, ausgeleuchteter Container: ein Szenario, das laut Roßnick zum ersten Mal in der Bundeswehr ausgebildet wird. Die 72-Stunden-Übung ist Teil eines zweiwöchigen Trainings, das sowohl einzelne Soldaten als auch das gesamte System an die Leistungsgrenzen bringen soll. Das wird schneller passieren als gedacht.
Im Keller des Feldwebelwohnheims bricht der Rost von Stahlträgern durch weiß gekalkte Wände. Elf Männer und Frauen trainieren hier, darunter zwei junge Militärärzte aus dem Berliner Bundeswehrkrankenhaus. Im schmalen Flur liegen Schutzwesten, Helme und Gewehre. Wer den Keller verlässt, um Verwundete hineinzutragen, muss all das anlegen. Schließlich ist so nahe der Front jederzeit mit Attacken zu rechnen. Letzte Handgriffe, bevor die erste Welle an Verletzten kommt. Die Atmosphäre ist konzentriert und ruhig. Da schrillt ein Warnton durch den Flur und die abzweigenden Kammern, in denen vier Behandlungsplätze und Medikamentenlager aufgebaut sind: Der Treibstoffkanister im Stromgenerator muss gewechselt werden. Alle bleiben fokussiert.
Belastende Aufgabe der Triage
Dann geht es los: Am Funk kündigt sich knarzend der erste Verwundetentransport an. „22.10 Uhr: ein Alpha-Patient!“ ruft Hauptfeldwebel Sabine Reschke (Name geändert) in den langgezogenen Keller. „22.10 Uhr ‒ ein Alpha-Patient!“, wiederholt das restliche Team zur Bestätigung. Reschke ist die taktische Führerin der Einheit, sie managt Personal und Material. Die medizinische Leitung übernimmt abwechselnd einer der beiden Ärzte. Damit verbunden ist auch die belastende Aufgabe der Triage: ankommenden Kameraden einen der Verletzungsgrade Alpha, Bravo und Charlie zuzuweisen, von schwer bis leicht. Und darüber zu entscheiden, wer so schwer verwundet ist, dass er keine der knappen Ressourcen bekommt und sterben wird.

Ein Rot-Kreuz-Unimog ohne Licht in der Dunkelheit stoppt vor dem Gebäude. Die nächsten 72 Stunden liefern die Unterstützungskräfte von außen abwechselnd medizinische Lehrpuppen oder geschminkte Rollenspieler mit Kriegsverletzungen an, wie sie auch in der Ukraine auftreten. Zwei Drittel aller Verletzungen werden dort durch Granatsplitter verursacht, ein Viertel durch explodierte Minen und ein Zehntel durch Schusswunden. Betroffen sind laut ukrainischem Sanitätsdienst vor allem Beine, Arme und der Hals-Kopf-Bereich. In Berlin bringen zwei Soldaten den ersten Verwundeten über den dunklen, L-förmigen Treppenabgang und hasten zu den Behandlungsräumen, doch Stabsarzt Sebastian Krischke (Name geändert) hält sie auf: „Erst zu mir!“ Krischke muss innerhalb von Sekunden den Verwundungsgrad festlegen und trifft damit eine Entscheidung über Leben und Tod. „Unterschenkelabriss ‒ Alpha,“ ruft der Stabsarzt.
Hunderte Verletzte pro Nacht für eine einzige Rettungsstation, das ist die Realität in der Ukraine, die Ausbildungsleiter Roßnick vermitteln will. In den Tagen vor der 72-Stunden-Übung hat er mit der Übtruppe darüber gesprochen, wie notfallmäßige Bestattungen markiert werden können ‒ für spätere Umbettungen. Wie Schwerverletzte in ihren letzten Stunden mit Schmerzmitteln versorgt werden. Und wie sie womöglich alleine in einer Kellerecke sterben, wenn Sanitäter ihre begrenzte Kraft aussichtsreicheren Fällen widmen. „Das sind sehr, sehr harte Entscheidungen“, sagt der Mediziner Roßnick. „Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir uns in Übungen damit auseinandersetzen müssen. Machen wir das erst im Notfall, könnten Patienten falsch kategorisiert werden. Und es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Behandler selbst mit psychischen Schäden aus dieser Situation rausgehen.“

Thomas Bretz-Rieck versucht sich in die Behandelnden hineinzuversetzen. Er ist Militärpfarrer. „Da liegt ein Verletzter vor mir, und ich möchte dem helfen ‒ kann es aber nicht“, fühlt sich Bretz-Rieck in die Lage ein. „Das ist eine grauenhafte Situation. Und die Person wird ja auch nicht einfach still sterben. Sie wird mich anflehen und festhalten.“ Das könne zu psychischen Verwundungen führen, wofür Sanitätskräfte besonders anfällig seien, erklärt der Seelsorger. Allerdings würden viele Bundeswehrangehörige solche psychischen Verletzungen verdrängen: „Für viele Soldatinnen und Soldaten sind Gefühle eine große Blackbox“, berichtet Bretz-Rieck von seinen Erfahrungen. Deswegen fordert er in Sachen emotionaler Kompetenz eine streitkräfteübergreifende Ausbildungsinitiative.
„Willkommen in der Wirklichkeit“
Oberfeldarzt Ramon Roßnick hofft in der Berliner Nacht indessen, dass sich während der intensiven Übung niemand an Körper oder Seele verletzt. Sein Wunsch bleibt unerfüllt. Denn plötzlich gellt ein Schmerzensschrei durch den Keller, der nicht von einem der Rollenspieler kommt. In der Dunkelheit hat sich ein Soldat beim Tragen von Verwundeten in der verwinkelten Treppe so stark verletzt, dass er mehrere Tage im Krankenhaus verbringen wird. Im Verlauf der Übung wird ein weiterer Kamerad verletzungsbedingt ausfallen. Von den elf Teammitgliedern der Rettungsstation bleiben neun übrig.
Derweil geht die Übung weiter. Immer mehr Verwundete werden angeliefert: Schusswunden, weggesprengte Gliedmaßen, Bewusstlose und eine vergleichsweise harmlose Schulterverletzung, die von Stabsarzt Krischke die Kategorie Charlie bekommt. Der Charlie-Patient wird auf den Feldbetten am Flurende hinter dem Funker „geparkt“, macht allerdings immer wieder mit lauten Schmerzensrufen auf sich aufmerksam. Das trägt nicht gerade zur Entspannung des Funkers bei. Er ist sowieso schon gestresst: Das Gerät funktioniert nicht richtig, immer wieder muss er Funksprüche wiederholen. Und dann baut sich auch noch ein aufgebrachter Ausbilder des Sanitätsregiments vor ihm auf. Der Grund: Bis jetzt hat noch niemand den Transport der versorgten Verletzten zum nächsthöheren Glied der Rettungskette angefordert. „Ihr müsst deutlich schneller werden!“, schnauzt der Ausbilder, während der Funker überfordert entgegnet: „Aber ich bin die ganze Zeit alleine hier!“ Was den aufgebrachten Feldwebel nicht interessiert: „Das ist mir scheißegal.“

Seit 55 Minuten sind die Patienten hier im System drin und ihr habt noch keinen Entlastungstransport angefordert. Jede Minute, die ihr hier verzögert, ist eine Minute länger, bis der Transport hier ist. Willkommen in der Wirklichkeit!“
Abläufe, die im Schulungsraum bei den meisten noch gesessen haben, geraten im Stress durcheinander. Dabei ist der Weitertransport ‒ möglichst in derselben Nacht ‒ wichtig: Denn erst in der nächsthöheren Versorgungsstation können Verwundete operiert werden. Bis dahin können Blutungen nur mit einfachen Mitteln versorgt werden ‒ etwa, indem sie straff abgebunden werden. Doch nach einer gewissen Zeit ohne Blutversorgung müssen Arme und Beine amputiert werden. Und manchmal hat es Tage gedauert, bis Verwundete überhaupt von der Front in den ersten Sammelpunkt gebracht werden konnten, wie ein ukrainischer Frontarzt in einer ZDF-Reportage berichtet (siehe unten). Demnach hatte ein Kamerad mit gebrochener Hüfte zehn Tage im Schützengraben ausharren müssen, im Schlamm, fast ohne Essen. Der Artilleriebeschuss war so stark, dass der Verletzte nicht früher abtransportiert werden konnte.
Umstellung von Notfallmedizin auf Intensivmedizin
Es kann lange dauern, bis Verletzte in den Sammelpunkt gebracht werden, und es kann ebenfalls lange dauern, bis sie von dort in Lazarette kommen, wo sie operiert werden können. Für das Sanitätspersonal bedeutet das, mental von Notfallmedizin auf Intensivmedizin umzustellen. Hinzu kommen pflegerische Aspekte: Wie viel Flüssigkeit haben die Verletzten aufgenommen und wieviel abgegeben? Was tun mit all dem Urin und Kot im Keller ziviler Häuser? Darüber haben viele Teilnehmer vorher noch nie nachgedacht, berichtet Oberfeldarzt Ramon Roßnick von der Vorbereitung auf die 72-Stunden-Übung.

Eine weitere bittere Lektion aus der Ukraine: Ob Verletzte überleben, hängt oft von den Kameraden der eigenen Gruppe ab. Denn die ersten zehn Minuten entscheiden darüber, ob Soldaten verbluten oder nicht. Kann der Kamerad neben mir mit dem Tourniquet umgehen, einer Schlinge zum Abbinden? Weiß die Kameradin, wie die blutstillenden Spezialkompressen richtig eingesetzt werden? Wenn die Bundeswehr kriegstauglich werden will, muss sie die Erste-Hilfe-Ausbildung aller Truppen stärker in den Fokus nehmen. Es wird auch darum gehen, nicht ärztlichem Rettungspersonal mehr Kompetenzen zu geben, etwa, was Bluttransfusionen angeht. Seitdem diese schon an der Front beginnen, ist der Anteil der Schwerverletzten, die es in die Klinik geschafft haben, in der Ukraine von zehn Prozent (2014) auf 40 Prozent (2024) gestiegen. Das seien Lektionen, die dringend in die Ausbildung aufgenommen werden müssen, sagt Roßnick: „Notfallsanitäter hatten bisher trotz ihrer dreijährigen Ausbildung meist einen Arzt dabei, von dem sie unterstützt wurden. Das werden wir in Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung so nicht leisten können. Der Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäterin muss also mehr Verantwortung übernehmen. Und darauf müssen wir sie natürlich auch vorbereiten.“
In der Berliner Nacht gibt es indessen einige betrübte Gesichter. Die schwere Verletzung des Kameraden nimmt das Team mit. Im Ernstfall wird die psychische Belastung um ein Vielfaches höher sein. Das zeigt auch die ZDF-Reportage, in der eine deutsche Anästhesistin interviewt wird. Die gebürtige Ukrainerin leistet einige Wochen im Jahr Freiwilligendienst nahe der Front. Ihre Strategie: So wenig persönliche Geschichten von Verletzten anhören wie möglich: „Es ist herzzerreißend, wenn Kameraden erfahren müssen, dass derjenige, den sie fünf Kilometer getragen und dann noch 30 Kilometer in fürchterlicher Geschwindigkeit über zerstörten Straßen gefahren haben, jetzt leider tot ist.“

Psychisch verletztem Sanitätspersonal beistehen ‒ eine Aufgabe auch für die 150 Militärseelsorger der Bundeswehr, sagt Pfarrer Bretz-Rieck: „Es gibt Überlegungen, dass wir in erster Linie genau diese Kameradinnen und Kameraden an den Hauptverwundetensammelplätzen begleiten. Da sind wir mit 150 Seelsorgern aber nicht wirklich durchhaltefähig. Wir haben ja auch keine Erfahrung, was das eigentlich mit uns selbst macht. An solch einem Hauptverwundetensammelplatz kommen jede Nacht Hunderte Leute rein, die Hälfte von ihnen stirbt, und wir bekommen keine Supervision. Wir haben im Moment keine Idee von Durchhaltefähigkeit.“
Vergewaltigung durch eigene Kräfte
Dabei ist Hilfe für die Psyche enorm wichtig für die Moral und damit für die Kampfkraft der Truppe. Genauso wie Widerstandsfähigkeit. Jedes Szenario, das Soldaten schon mal in Übungen durchlaufen haben, kann von ihnen in der Realität besser bewältigt werden. Ein Szenario fehlt allerdings in der 72-Stunden-Übung im Berliner Feldwebelwohnheim: eine Vergewaltigung durch eigene Kameraden. Dies ist eine tragische Strategie von Soldaten, um eigene Gefühle von Ohnmacht, Angst oder Trauer nicht mehr spüren zu müssen, die in jedem Krieg vorkommt. Betroffene sind Soldatinnen genauso wie Soldaten. Auch in der Ukraine, wie eine ukrainische Front-Sanitäterin im Gespräch mit loyal berichtet: „Ein beliebter Kamerad von uns ist gestorben. Wir haben an dem Abend alle viel Alkohol getrunken, um die Trauer nicht fühlen zu müssen. Ich bin dann ins Bett gegangen, weil mir schwindelig war. Und dann ist einer von den Jungs in mein Bett gekommen und wollte Sex mit mir. Ich war einfach nur noch erschöpft und fertig und wollte schlafen. Aber er hat so darum gebettelt, und ich hatte Mitleid mit ihm, weil sein Freund getötet wurde. Irgendwann hat er mich dann an den Punkt gedrängt, wo ich den Sex über mich ergehen ließ, obwohl ich das nicht wollte.“

Vergewaltigung durch eigene Kräfte: dieses Thema komme in der Ausbildung grundsätzlich nicht vor, sagt Flottillenärztin Jessica Ritter*, Gleichstellungsbeauftragte im Marinekommando Rostock. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist selbst Angehörige der Sanität. „Dieses Thema wird tabuisiert“, sagt Ritter. „Wenn überhaupt, dann ist es in der Vorstellung der Bundeswehr immer der Gegner, der vergewaltigt, aber natürlich nicht eigene Kräfte, weil wir ja die Innere Führung haben. Ja, die haben wir, und wir haben auch Gesetze, laut denen so etwas nicht stattfinden darf. Nur beobachte ich leider, dass es auch im Grundbetrieb der Bundeswehr Vergewaltigungen gibt, und gehe davon aus, dass das dann in einem Krieg eskalieren würde.“
Dass das Thema „Vergewaltigung durch eigene Kräfte“ in der Ausbildung nicht thematisiert werde, sei ein Mangel, der sich negativ auf die Kriegstüchtigkeit auswirke. Das habe sie bei Betroffenen selbst erlebt, berichtet die Medizinerin: „Wer diesen Menschen in die Augen schaut, sieht einfach nichts mehr. Da ist eine völlige Abwesenheit. Die Betroffenen sind nicht mehr in der Lage, zu kämpfen. Und auch andere Kameradinnen und Kameraden, die solche Vergewaltigungen mitbekommen und sehen, dass keiner was dagegen macht, und wie schlecht es den Betroffenen ergeht, auch bei denen ist die Kampfkraft vermindert.“ Deswegen müsse die militärische Führung diesen Ausbildungsmangel schnell abstellen, fordert Ritter.

An nötigen Veränderungen mangelt es also nicht. Auch auf struktureller Ebene: Wenn mehr als tausend Verwundete pro Tag erwartet werden, reichen die Kapazitäten im Lufttransport nicht aus. Stattdessen müssen Sanitätszüge aufs Gleis gebracht werden, wie es sie auch in der Ukraine gibt. Auch vom lieb gewonnenen roten Kreuz wird sich die Truppe wohl verabschieden müssen: Obwohl völkerrechtlich als Schutzzeichen festgeschrieben, sieht die russische Armee in dem Kreuz eher eine Zielscheibe. Sanitätspersonal wird laut Berichten besonders ins Visier genommen, um die Moral der Truppe anzugreifen. Doch auch durch die Berliner Nacht rumpeln die Unimog-Krankentransporter noch mit einem riesigen roten Kreuz.

Die politische und militärische Führung hat sich wegen der veränderten Bedrohungslage dazu entschlossen, die bisherigen militärischen Organisationsbereiche der Streitkräftebasis und des Zentralen Sanitätsdienstes in einem neuen Unterstützungsbereich unter der Führung eines neu aufzustellenden Unterstützungskommandos zusammenzufassen. Das soll die Koordination vereinfachen. Ob dieser Plan aufgeht, ist jedoch unklar. Aus dem Sanitätsdienst selbst kommt auf loyal-Anfrage eine erstaunlich ehrliche Antwort: „In der Praxis könnte der Abstimmungsaufwand innerhalb des neuen Unterstützungsbereichs unter anderem durch die zusätzlich eingezogene Führungsebene auch steigen. Auswirkungen lassen sich heute noch nicht exakt prognostizieren.“
Ein letzter Blick nach Berlin
Am Ende der 72-Stunden-Übung blickt Oberfeldarzt Ramon Roßnick in abgekämpfte und gleichzeitig zufriedene Gesichter: „Die Teilnehmer haben gesagt, wie wichtig es gewesen sei, diese Übung im Keller zu machen. Es sei eine der forderndsten Ausbildungen gewesen, die sie je gemacht hätten. Und sie fühlten sich jetzt besser vorbereitet auf das, was sie erwarten kann.“ Roßnick ist erleichtert. Mit der Übung geht auch für ihn eine anstrengende Phase zu Ende. Sechs Monate hat er die Ausbildung vorbereitet, neben seinem sonstigen Dienst. Woher kommt diese tiefe Entschlossenheit? Will er mit der hochwertigen Ausbildung dazu beitragen, dass möglichst viele Kameradinnen und Kameraden einen möglichen Krieg überleben?
„Ja, das ist natürlich ein Punkt“, sagt er. „Gleichzeitig geht es mir um mehr: Ich will, dass die Bundeswehr einsatzbereit bleibt, um unser Wertesystem zu verteidigen. Zum einen ganz grundsätzlich, zum anderen habe ich persönlich noch einen Grund: Ich bin homosexuell und habe eine klare Vorstellung von dem, was passieren würde, wenn ein Putin-Regime in Deutschland an der Macht wäre. Das wäre kein Staat, in dem ich leben möchte. Das zu verhindern ist sicherlich auch ein großer Teil meiner Motivation, hier eine möglichst kriegs- und einsatznahe Ausbildung zu ermöglichen.“
Anmerkung: * Flottillenärztin Jessica Ritter nutzt selbst diese weibliche Dienstgradbezeichnung, auch wenn der Dienstgrad laut Vorschrift für Frauen ebenfalls Flottillenarzt lautet.
Die Autorin
Julia Weigelt ist Fachjournalistin für Sicherheitspolitik aus Hamburg.