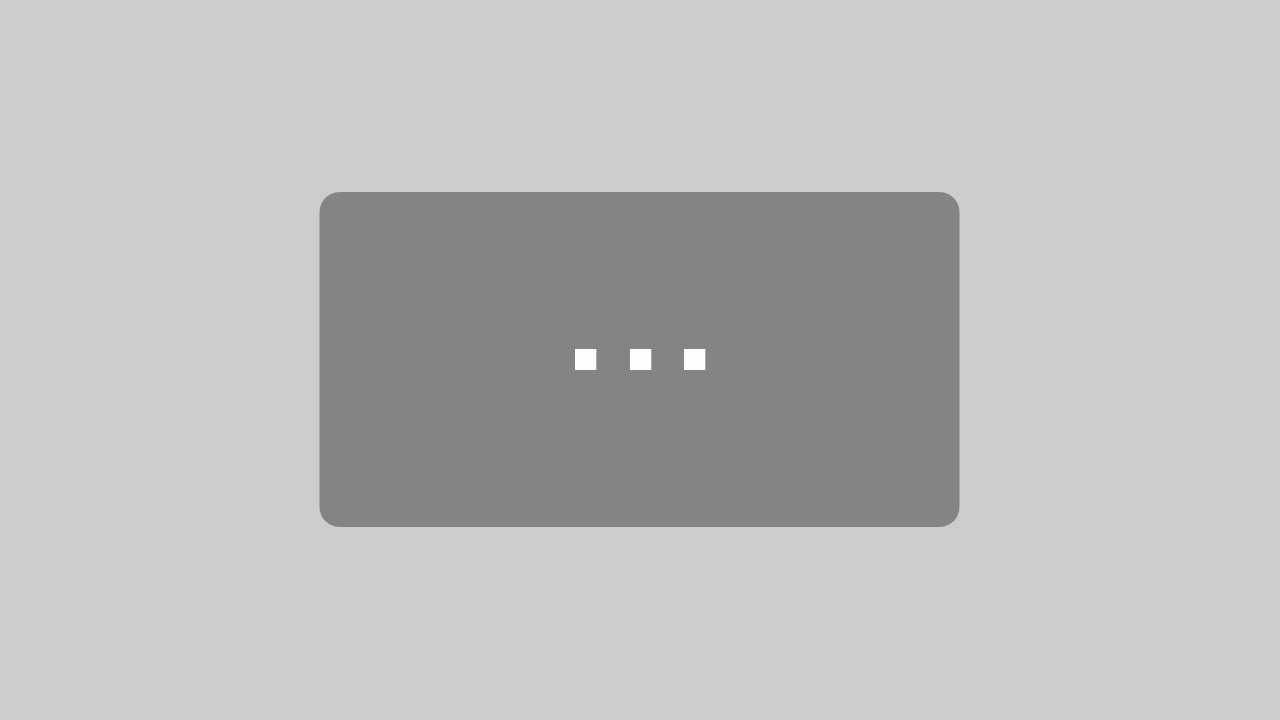Wie der „Gepard“ den Ukrainern helfen kann
Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Unterstützung durch ein komplexes Waffensystem.
Die Bundesregierung wird die Ukraine mit Flugabwehrpanzern vom Typ „Gepard“ ausstatten. Das gab Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) beim Treffen der „Ukraine Security Consultative Group“ auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz bekannt. Die Consultative Group ist eine von den USA ins Leben gerufene Plattform zu Koordinierung der Waffenhilfe unter den Westmächten, vornehmlich der NATO-Staaten.
Der „Gepard“-Flugabwehrpanzer wird in der Bundeswehr seit mehr als zehn Jahren nicht mehr genutzt. Die Bundesregierung genehmigte den Export von Lagerbeständen des Gepard-Hersteller Krauss-Maffei-Wegmann (KMW). Schon seit Kriegsbeginn bietet KMW 50 Stück der Ukraine zum Kauf an. Auf die Frage, warum Deutschland erst jetzt die Lieferung der „Gepard“-Flugabwehrpanzer genehmigt, reagierte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Ramstein mit der Ausweichformel: „Wir prüfen fortwährend und agieren in ständiger Abstimmung mit unseren Alliierten.“
Kampfszenario erinnert an Kalten Krieg
Der „Gepard“ wurde zu Beginn der 1970er-Jahre in die Bundeswehr für die sogenannte mobile Flugabwehr im Nahbereich eingeführt. Er ist darauf ausgelegt, Panzerverbände im Gefecht zu begleiten und diese vor Luftangriffen abzuschirmen, indem er Attacken von Hubschraubern und Kampfflugzeugen zerschlägt. Dafür verfügt der Kettenpanzer über eine Zwillings-Maschinenkanone, die in hoher Kadenz verschiedene Munitionsarten verschießen kann. Die Bundeswehr des Kalten Krieges war als Panzerarmee ausgelegt, die einen massiven russischen Angriff verzögern sollte, weswegen eine starke mobile Flugabwehr als essenziell galt. Sie sorgte dafür, dass die Panzer den Bodenkampf führen können, ohne rasch aus der Luft vernichtet zu werden. Ein solches Kampfszenario steht den Ukrainern nun auch in den Weiten des Donbass vor, wenn es darum geht, massiven Vorstöße russischer mechanisierter Kräfte mit eigenen Panzern entgegenzutreten.
Laut dem Jahresbericht „Military Balance 2021“ verfügte die ukrainische Armee zu Kriegsbeginn noch über 75 Flugabwehrpanzer „Tunguska“ – dem sowjetischen Pendant des „Gepard“. Die Verlustzahlen sind nicht bekannt. Klar ist, dass die Ressourcen und Möglichkeiten der Ukrainer, ihre postsowjetische Militärtechnik ins Feld zu führen, rapide abnehmen, je länger der Krieg dauert. So liegt die größte Panzerproduktions- und Instandsetzungsstätte des Landes im schwer umkämpften Charkiw.
Für die Frühjahrsoffensive der Russen, die gerade Gestalt annimmt, stellen die „Geparden“ allerdings keine Berdrohung dar. Die Ausbildung von Mannschaften samt Technikern plus Aufbau einer Logistikkette wird mehrere Monate dauern. Hier gibt die Ausstattung Rumäniens mit „Gepard“-Flugabwehrpanzern Anfang der 2000er-Jahre eine Orientierung. Bis 2004 erhielten die rumänischen Streitkräfte 43 „Geparden“ der älteren Baureihe B2L. Heute bilden diese zwei Flugabwehrbataillone, je eines davon gehört zu den beiden Heeresdivisionen Rumäniens.

Oberstabsfeldwebel a. D Wolfgang Sommer war Planer und Leiter der Ausbildung für die rumänischen Stammbesatzungen. Er und sein Team von vier Feldwebeln mit Dolmetschern bildeten zwischen den Jahren 1999 bis 2000 circa 27 rumänische Heeressoldaten am „Gepard“-Flugabwehrpanzer aus. Sommer im Gespräch mit .loyal: „Nach der kompakten Fahrausbildung kam die Bediener-Ausbildung. Neun Monate dauerte diese. Parallel dazu wurde eine Infrastruktur im rumänischen Turda mit Unterständen und Werkstätten aufgebaut.“ Ausgebildet wurden Offiziere als Kommandanten sowie Unteroffiziere als Fahrer und Bediener der Waffenanlage sowie als Instandsetzer für diese und die Elektronik. „Von Vorteil war, dass die Rumänen damals alles noch Handwerker waren. Das heißt, es gab ein technisches Grundverständnis. Ich bezweifle, ob das heute noch so wäre.“
Zentrum von Ausbildung und Training war der Truppenübungsplatz Putlos mit eigenen Hallen für drei Übungs-Geparden samt Instandsetzung plus Simulatoren. „Damals wurde das Ausbildungsvorhaben stark von der Leitung des Wehrressorts unterstützt. Wir konnten aus dem vollen schöpfen: Übungsplätze zu erhalten, war unkompliziert. Munition gab es in rauen Mengen.“
„Neun Monate gerade ausreichend“
Dort wurde teils in Schichten oft rund um die Uhr gearbeitet. Ausgangspunkt war ein komplett zerlegter „Gepard“, an dem die Technik erläutert wurde. Dann wurden in kleinen Gruppen auf so genannten „Stationen“ gelernt. Beispielsweise, wie man diverse Störungen am Panzer beseitigt, Hubschrauberabschuss am Simulator oder reale Flugzielbekämpfung mit der Hilfe von Zieldarstellungsflugzeugen wie einem Learjet. Abends gab es noch Deutschkurse für die Rumänen. Essenziell war auch das praktische Training für die Bewegung im Gefecht sowie die Feldinstandsetzung, so Sommer. „Drillmäßig haben die neun Monate gerade ausgereicht.“
Sommer schätzt, dass es bestenfalls sechs Monate Ausbildung und technische Vorbereitung braucht, damit die Ukrainer den Flugabwehrpanzer sinnvoll zum Einsatz bringen können. Dieser wäre für die ukrainische Armee besonders fordernd, so der „Gepard“-Fachmann. Die Bundeswehr setzte die „Geparden“ zuletzt in einem Kampfsystem ein. Ein weit entferntes Radargerät verteilte Zielkoordinaten an die einzelnen Flugabwehrpanzer. Sowohl Flugabwehraufklärung als auch Feuerleitung übertrugen die Daten verschlüsselt. Die „Geparden“ mussten somit ihr eigenes Radar nicht mehr nutzen, um Gegner zu erfassen, was ihre Entdeckung durch Radarabstrahlung erschwerte. In solch einem System können die Ukrainer ihre „Geparden“ nicht einsetzen, sondern nur mit aktivem Eigen-Radar, was sie verwundbarer macht.
Übung und Routine unabdingbar
Auch Markus Richter sieht einen künftigen „Gepard“-Einsatz der Ukrainer mit speziellen Herausforderungen. Richter ist Ex-Ausbilder am „Gepard“ und Spezialist für Flugabwehr*. Bekannt ist er als „Gepardtatze“ auf Twitter, wo er Flugabwehr-Themen analysiert. Routinemäßiger Drill wäre laut Richter entscheidend für einen hohen Einsatzwert der „Geparden“ im Donbass. „Wenn eine Besatzung im Gefecht zu lange braucht, um einen Fehler zu beseitigen, weil das Erfahrungswissen fehlt, ist die Gefahr groß, dass das Waffensystem aufgegeben werden muss.“ Routine gibt es aber nur über stetige Übungsfahren und Manöver, für die in der Kriegsdynamik die Zeit fehlt.
Richter hält eine Einsatzbereitschaft der Ukraine-„Geparden“ in zwei bis fünf Monaten für machbar. Zwei Monate wären der Idealfall. „Hier müssten jedoch alle Faktoren optimal ineinandergreifen. Das heißt, eine Ausbildung mit motivierten ukrainischen Flugabwehr-Soldaten, die über ihr Gerät bereits die Einsatzgrundsätze beherrschen sowie eine rasche technische Aufbereitung durch die Industrie“, so „Gepard“-Spezialist Richter. Eine Ausbildung über die Bundeswehr kommt nicht mehr in Frage, weil hier inzwischen die Kompetenz fehlt, machte Generalinspekteur Eberhard Zorn im Podcast „Aus Regierungskreisen“ deutlich.
Bei der technischen Vorbereitung der eingemotteten Flugabwehrpanzer liegt der Teufel liegt oft im Detail. Die Eingabemaske des Bedienpults bei den „Geparden“, die für die Ukrainer vorgesehen sind, ist in deutscher Sprache. Wie für Katar oder andere Kunden, muss diese von KMW erst angepasst werden. Richter hofft, dass die Ukrainer schon bei der Fahrzeugaufbereitung bei KMW mitmachen. „Das würde die Ausbildung an der Technik beschleunigen.“ Interessant wird auch im Ausblick, ob Rumänien als letzter „Gepard“-Betreiber in der NATO seine Instandsetzungskapazitäten für die Ukrainer zur Verfügung stellt oder sogar einen Wartungspunkt in Grenznähe aufbaut.
*Richter gibt hier ausschließlich seine Meinung als Privatperson wieder.